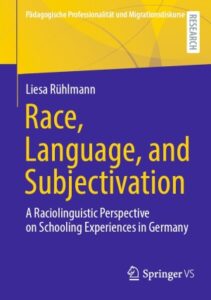A Raciolinguistic Perspective on Schooling Experiences in Germany
Wiesbaden: Springer VS 2023
(284 S; ISBN 978-3-658-43151-8; 109,99 EUR)
Liesa Rühlmann untersucht in ihrer auf Englisch verfassten Dissertation die Intersektion von ‚race‘ und Sprache an deutschen Schulen. Dafür befragt sie zwölf unterschiedlich positionierte Erwachsene retrospektiv nach ihren mehrsprachigkeitsbezogenen Schulerfahrungen. Im Laufe des Forschungsprozesses erweiterte sie ihre Fragestellung im Hinblick darauf, wie nicht-rassialisierte und rassialisierte ehemalige Schüler*innen mehrsprachigkeitsbezogene Schulerfahrungen konstruieren, wie sich diese Erfahrungen unterscheiden und welche Subjekt(re-)positionierungen dabei (re-)produziert werden. Die Relevanz ihrer Arbeit begründet Rühlmann in eben dieser Intersektion, da subjektivierungstheoretische Arbeiten bisher entweder Mehrsprachigkeit oder ‚race‘ untersucht haben.
Die Dissertationsschrift ist in eine Einleitung mit Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zur deutschen Migrationsgesellschaft und zum deutschen Schulsystem, drei Theoriekapitel (zu ‚race‘, Mehrsprachigkeit und Subjektivierungstheorie), ein ausführliches Methodenkapitel, vier Ergebniskapitel und ein Fazit gegliedert. In den Theoriekapiteln übersetzt Rühlmann englischsprachige Diskurse für ein deutschsprachiges Publikum und umgekehrt, etwa ‚Critical Race Theory‘/Rassismuskritik und ‚raciolinguistic perspective‘/Linguizismus. Deutlich wird, dass der Fokus der ‚raciolinguistic perspective‘ auf das ‚white listening subject‘, welches eine ‚raciolinguistic norm‘ und ‚raciolinguistic Others‘ erst herstellt, sowie auf die „co-naturalization“ (Flores & Rosa, 2023, 425) [3] von ‚race‘ und Sprache als koloniales Verhältnis und als Form anhaltender Kolonialität zentral für Rühlmanns Arbeit sind.
Nach einem Überblick über aktuelle Studien zum Sprachgebrauch an deutschen Schulen, legt Rühlmann ihren positionierungstheoretischen Ansatz dar, der auf einem Butlerschen Diskursbegriff fußt. Sie stellt die Bedeutung diskursiv hergestellter und verhandelter Subjektpositionen heraus, die von Menschen eingenommen, zurückgewiesen und verändert werden können und dabei immer eine Relevanz für die (Re-)Positionierungen der entstehenden Subjekte behalten. Rühlmann spricht daher in ihrer Arbeit konsequent von Re-Positionierungen anstelle von Positionierungen.
In ihrem Methodenkapitel reflektiert Rühlmann ihre Positioniertheit als ‚weiße‘ Forscherin und damit als Repräsentantin des ‚white listening subjects‘. Dies habe große Relevanz für die Frage, wie sicher sich Interviewpartner*innen dabei fühlen können, über Diskriminierungserfahrungen zu sprechen, weil diese häufig von ‚weißen‘ Zuhörenden und Institutionen diskreditiert werden. Daher achtete Rühlmann darauf, dass die Interviewpartner*innen sie und ihre rassismuskritische Haltung bereits kannten oder dass Kontaktpersonen für ihre Vertrauenswürdigkeit bürgen konnten. Zudem fragte sie bewusst nicht nach Linguizismus- oder Rassismuserfahrungen, um den Interviewten die Entscheidung zu überlassen, ob sie dies thematisieren wollten oder nicht. In ihrem Sample bildet Rühlmann unterschiedlich positionierte Mehrsprachigkeiten ab: ‚weiß‘ und Schwarz positionierte Sprecher*innen prestigereicher Sprachen sowie Sprecher*innen dekapitalisierter Sprachen, von denen manche white-passing sind bzw. um ein solches Passing kämpfen. Rühlmann stellt in diesem Kapitel außerdem ihre Analyseschritte entlang der konstruktivistischen Grounded Theory Methodologie nach Charmaz (2014) [1] vor.
Im ersten Ergebniskapitel geht es um (Selbst-)Bezeichnungen der Interviewpartner*innen entlang rassialisierender Diskurse. Die Selbstbezeichnung ‚Schwarz‘ wird von drei Interviewpartner*innen verwendet, die sich aktiv mit dieser Positionierung auseinandersetzen. Die Bezeichnung ‚weiß‘ wird nur von Forschungspartner*innen verwendet, die selbst von Rassialisierungserfahrungen erzählen, und zwar für Erzählungen über andere. Einige Interviewpartner*innen positionieren sich indirekt, jedoch nie explizit, als ‚weiß‘, indem sie sich von Personen abgrenzen, die sie als ‚mit Migrationshintergrund‘ bezeichnen. Insgesamt wird deutlich, dass die Bezeichnung ‚deutsch‘ als Synonym zu ‚weiß‘ konstruiert wird: Die (Selbst-)Bezeichnung ‚deutsch‘ wird als Gegensatz zu ‚mit Migrationshintergrund‘ verwendet, und ‚mit Migrationshintergrund‘ als Gegensatz zu ‚weiß und mit Migrationshintergrund‘. Personen, die sich auf diese Weise vom Nicht-‚Weißsein‘ abgrenzen, verwenden den Begriff ‚weiß‘ nicht und zeigen keine aktive Auseinandersetzung mit der Erfahrung, ‚weiß‘ und nicht-rassialisiert positioniert zu werden.
Das zweite Ergebniskapitel zum Sprachengebrauch in der Schule zeigt auf, wie sehr die Schule als deutschsprachiger Raum konstruiert ist. Außerhalb der Fremdsprachenfächer wird das Sprechen von ausschließlich Deutsch erwartet. Der Herkunftssprachliche Unterricht wird von den Interviewpartner*innen als unwichtig erinnert, und der Besuch sogenannter DaZ-Klassen wird von denjenigen, die eine solche Klasse besucht haben, als Exklusionserfahrung benannt. In den Pausen sprechen Schwarz oder als Person of Colour (BPoC) positionierte Schüler*innen überwiegend Deutsch, um nicht aufzufallen. Die ‚weiß‘ positionierten Mehrsprachigen schränken ihren Sprachengebrauch hingegen nicht ein; ihr Englisch- und Französisch-Sprechen wird unterstützt. Sie reflektieren diese Positionierung jedoch nicht. Es wird deutlich, dass das deutsche Sprachgebot für ‚weiß‘ positionierte Mehrsprachige nicht gilt. Somit ist der monolinguale Habitus tatsächlich eher auf die Produktion eines ‚weiß‘ normierten als eines deutschsprachigen Raums ausgerichtet, in dem die Unterscheidung zwischen erwünschtem und unerwünschtem Sprechen entlang der Kategorie ‚race‘ getroffen wird.
Im dritten Ergebniskapitel geht es um die Erfahrung, linguistische Kompetenz zu- oder aberkannt zu bekommen, je nach der eigenen ‚raciolinguistic positionality‘. Dieses Kapitel zeigt die Produktion einer ‚raciolinguistic norm‘ und von davon abweichenden ‚raciolinguistic Others‘ als zentrale Schulerfahrung von BPoC positionierten Menschen. Diese reflektieren intensiv darüber, wie ihre Sprach(en)kompetenzen immer wieder und über Jahre hinweg abgewertet wurden. Dies betrifft auch das Sprechen prestigereicher Sprachen wie Englisch und Französisch, in dem sie nicht unterstützt werden, auch nicht im entsprechenden Fremdsprachenunterricht. Ihr Sprechen wird dort, anders als das von ‚weiß‘ positionierten Personen, die die Sprachen ebenfalls als Familiensprachen sprechen, nicht zur Norm erklärt. Auch vereinzelt erhaltene Komplimente zum Sprachgebrauch weisen darauf hin, dass von ihnen grundsätzlich keine Expertise erwartet wird. Somit wird deutlich, dass die Unterscheidung zwischen erwünschtem und nicht erwünschtem Sprachengebrauch nicht über das Prestige von Sprachen oder das Fremdsprachenangebot, sondern über die Kategorie ‚race‘ konstruiert wird. ‚Weiß‘ positionierte Sprecher*innen berichten zwar davon, dass sie zu ‚expert speakers‘ gemacht wurden, setzen sich aber nicht mit dieser Positioniertheit auseinander.
Im vierten Ergebniskapitel geht es um die Machtverhältnisse innerhalb der Schule. Die als BPoC positionierte Forschungspartner*innen erleben ein starkes Machtgefälle, was sich unter anderem in als unfair erlebten Benotungen und Beeinträchtigungen der Bildungsbiographie zeigt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass die als ‚raciolinguistic Others‘ positionierten ehemaligen Schüler*innen Elemente einer widerständigen Überlebenskunst (Seukwa 2006) [5] entwickelt haben. Dazu zählen z.B. Humor, intensive Reflexion oder die bewusste Entscheidung, Gefühle der Verletzung nicht zu zeigen. Für manche Interviewteilnehmer*innen ist auch das Investieren von viel Zeit in die deutsche Sprache Teil dieser Widerständigkeit, was sie deutlich als eigene Entscheidung markieren.
Rühlmann fasst im Fazit zusammen: Der Sprachgebrauch in der Schule werde nie nur in Bezug auf die Sprache, sondern immer auch in Bezug auf ‚Weißsein‘ beurteilt. Die Herstellung einer ‚raciolinguistic norm‘ und von ‚raciolinguistic Others‘ prägt die Schulerfahrungen der Forschungspartner*innen auf grundlegende und für rassialisierte Schüler*innen auf eine sehr benachteiligende Weise. Ein weiteres zentrales Ergebnis ist, wie wenig sich ‚weiße‘, als ‚raciolinguistic norm‘ positionierte Forschungspartner*innen mit dieser Positionierung auseinandersetzen. Aus diesen beiden Gründen fordert Rühlmann eindringlich, Ideologien und Wissenssysteme, die das ‚white listening subject‘ erzeugen, zu erkennen und abzubauen. Zudem müssten ‚race‘ und Rassialisierung in jeder Forschung zu Sprachgebrauch an Schulen miterforscht werden. Für diese Forderung liegt mit Rühlmanns Arbeit nun eine gewichtige empirische Begründung vor.
Nicht zuletzt stellt Rühlmanns Reflexion ihrer Positioniertheit als ‚weiße‘ Forscherin eine wegweisende Leistung dar. Ihre Transparenz, selbst ein ‚white listening subject‘ zu repräsentieren, und ihr Bemühen, damit reflexiv umzugehen, können in der dargestellten Ruhe, Differenziertheit und Konsequenz als Anleitung für weiße Forschende dienen, ihre Forschung grundlegend rassismus- und linguizismuskritisch zu gestalten – und das über Fächergrenzen hinweg. Was in dieser Arbeit noch nicht erfolgt, ist eine Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der hier vor allem herangezogenen ‚raciolinguistic perspective‘ zum Linguizismusbegriff von Dirim (2010) [2], der ebenfalls Linguizismus als Form von Rassismus beschreibt (siehe hierzu jedoch Rühlmann & Füllekruss, 2023) [4]. Eine solche Auseinandersetzung wäre gerade aufgrund der durchaus weiterführenden Begriffsangebote der ‚raciolinguistic perspective‘, wie etwa das ‚white listening subject‘, für Leser*innen interessant, die mit dem deutschsprachigen Diskurs zu Linguizismus vertraut sind. Nichtsdestotrotz leistet Rühlmann mit ihrer Dissertation einen bedeutenden Beitrag zum Fachdiskurs zur Verschränkung der Kategorien ‚race‘ und Sprache. Die Lektüre ist für alle, die an den Themen Sprache, Macht und Bildung interessiert sind, sehr empfehlenswert.
M. Knappik (Wuppertal/Göttingen)
[1] Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd edition). Introducing qualitative methods. Sage.
[2] Dirim, I. (2010). „Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent denkt oder so.“: Zur Frage des (Neo)Linguizismus in den Diskursen über die Sprache(n) der Migrationsgesellschaft. In P. Mecheril, I. Dirim, M. Gomolla, S. Hornberg & K. Stojanov (Hrsg.), Spannungsverhältnisse. Assimilationsdiskurse und interkulturell-pädagogische Forschung. Gefälligkeitsübersetzung: Tense relationships. Assimilation discourses and research on intercultural pedagogics (S. 81–112). Waxmann.
[3] Flores, N. & Rosa, J. (2023). Undoing raciolinguistics. Journal of Sociolinguistics, 27(5), 421–427. doi.org/10.1111/josl.12643
[4] Füllekruss, D. & Rühlmann, L. (2023). Sprache, Rassismus- und Linguizismus(kritik). Migrationspädagogische Zweitsprachdidaktik, 2, 34–57. doi.org/10.25365/mpzd-2023-2-3
[5] Seukwa, L. H. (2006). Der Habitus der Überlebenskunst: zum Verhältnis von Kompetenz und Migration im Spiegel von Flüchtlingsbiographien. Bildung in Umbruchsgesellschaften: Bd. 5. Waxmann.